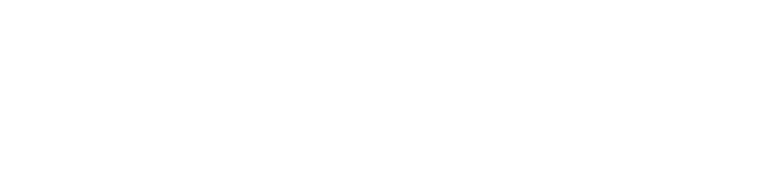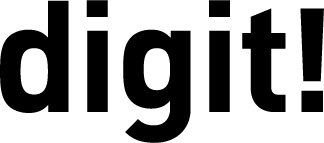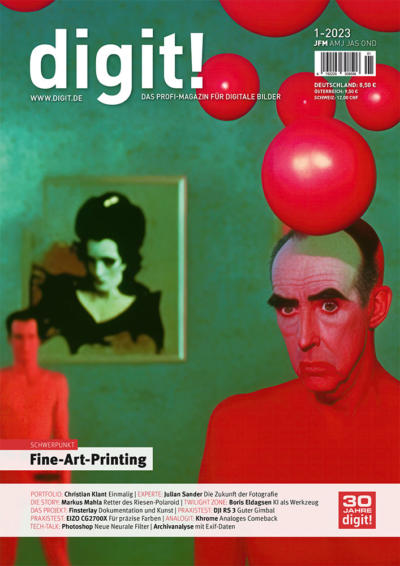Klassische Fotografie ohne Zukunft
Der Galerist Julian Sander hat mit Peter Schuffelen unter anderem über vor- und rückwärtsgewandte Technologien gesprochen.

digit!: Herr Sander, lange galten Diasecs – oder allgemein fotochemische Prints hinter Acryglas – zumindest im Kunstsegment als Goldstandard. Wie ist das heute?
Julian Sander: Das hat sich total verändert. Man weiß ja inzwischen, dass Diasecs nicht immer besonders haltbar sind und, wie andere fotochemische Verfahren – C-Prints etwa –, einer vergleichsweise schnellen Alterung unterworfen sind. Die Haltbarkeiten sind bei digitalen Drucktechniken, Stichwort Inkjet, deutlich besser.
Das frühere Akzeptanzproblem von Inkjetdrucken im Kunstmarkt ist heute kein Thema mehr?
JS: Es ist noch ein Thema, aber bei Weitem nicht mehr ein so großes wie früher. Was unter anderem auf die hervorragenden Medien der Papierhersteller sowie die Tinten zurückzuführen ist, die ja inzwischen Inkjetdrucke in „Barytqualität“ ermöglichen. Digitale Ausgabeverfahren haben darüber hinaus eine Reihe weiterer Vorteile: Die Umweltbelastung ist nicht so hoch, die Medienvielfalt ist größer, die Produktionskosten sind deutlich geringer, und die Reproduzierbarkeit ist sehr verlässlich.
Letzteres galt aber auch schon für Laser-Print-Verfahren ...
JS: Das stimmt, allerdings verschwinden diese Maschinen vom Markt. Finisher kaufen inzwischen bereits gebrauchte Maschinen als Ersatzteillager, um ihren Maschinenpark am Laufen zu halten.
Welche Medien sind am Markt derzeit besonders gefragt?
JS: Darauf gibt es keine generische Antwort. Für den Marktwert eines Kunstwerks sind viele Faktoren entscheidend, insbesondere das Konzept und der Bildinhalt. Die Präsentationsform, die Größe, die Rahmung oder Kaschierung sind ja in der Regel vom Künstler selbst vorgegeben, und entweder das findet bei den Käufern Anklang oder eben nicht.
Beraten Sie die Künstler in dieser Hinsicht?
JS: Ja, allerdings nicht in dem Sinne, wie was exakt aussehen soll. Es handelt sich um Lösungen, die wir gemeinsam entwickeln. Zwei Beispiele: Im Falle von Jory Hulls Serie „My Mind Is Racing“ haben wir überlegt, dass die Motive, die Rennwagendetails zeigen, als Hochglanz-Inkjetprints auf Alu Dibond hinter Museumsglas – also reflexfrei – am besten wirken, weil sie so eine geradezu dreidimensionale Wirkung entfalten. Bei Sean Hemmerles Serie „THEM“ haben wir uns am Ende dazu entschieden, Nassabzüge auf Barytpapier zu fertigen, weil diese Serie so optimal zur Geltung kommt – obwohl die Bilder zum Teil digital entstanden sind.
Welche Rolle spielt das Format?
JS: Ein verbreitetes Argument lautet: Groß ist gut, weil man an große Formate ein großes Preisschild hängen kann. Mich persönlich nervt das, weil große Formate die Lagerung und die Logistik erschweren und verteuern. Außerdem ist es ja so: Die meisten Sammler können große Formate gar nicht sinnvoll platzieren. Ein Bild jenseits des Formats 50 x 60 cm kann ich, wenn es bei mir im Flur hängt, wegen des fehlenden Abstands gar nicht richtig beurteilen und damit würdigen.
Welche Editionsgrößen empfehlen Sie?
JS: Ich rate zu überhaupt keinen Editionen. Der Vormarsch der Edition stammt aus den 1970er-Jahren und dem Run auf Prints von Leuten wie Ansel Adams. Aus meiner Sicht hat sich der Nutzen des Editions-Prinzips überholt. Die Leute denken: Wow, eine Edition, die muss wertvoll sein, weil es nur sieben Exemplare gibt! Aber das ist Blödsinn. Es gibt gute Bilder, und die werden nicht dadurch schlechter bzw. schlechter verkäuflich, dass 200 Stück davon existieren. Wenn ein Bild wirklich gut ist, werden Sie es trotzdem haben wollen. Ist ein Bild Mist, dann hilft es nichts, dass es davon nur drei Exemplare auf diesem Planeten gibt. Verkäuflich ist verkäuflich, und unverkäuflich ist unverkäuflich.
Gefühlt zeigt gerade jeder zweite Fotograf auf Instagram Bilder, die mit der Leica M6, Polaroid oder anderen analogen Werkzeugen entstanden sind. Spielt die Renaissance des Analogen im Kunstmarkt eine Rolle?
JS: Die Problematik des Analog-Hypes ist, dass viele Bildschaffende glauben, durch eine bestimmte Technik eine künstlerische Tiefe erzeugen zu können, die sie auf anderem Weg nicht erzeugen könnten. Natürlich gibt es Arbeiten, bei denen die qualitative Begrenzung – etwa durch alte Techniken – ein integraler Teil des Werks ist. Was ich aber zunehmend beobachte, ist: Menschen glauben, dass sie automatisch etwas von Wert produzieren, wenn sie nur genug handwerkliches Können und Zeit, in sagen wir, einen „Wet Plate Collodion“-Prozess stecken. Das ist ein Trugschluss, …
Lesen Sie den kompletten Beitrag in der aktuellen Ausgabe
-
digit! 1-2023
6,00 € – 8,50 €Umfang: 100 Seiten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage