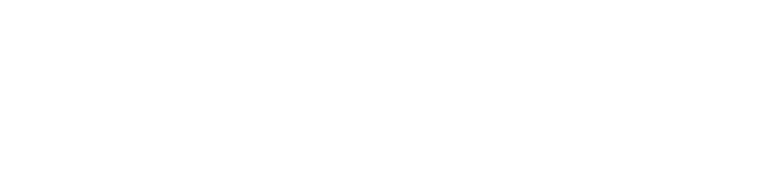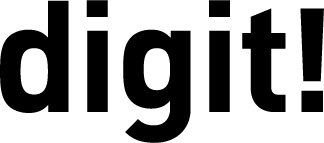„Filmen ist wie Basketball spielen.“
Professor Andreas Bechtold von der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) über die filmische Ausbildung und die unterschiedlichen Anforderungen von Bewegtbildern und Stills. Von Peter Schuffelen

Herr Bechtold, Sie erarbeiten mit den Studenten des Studiengangs Kommunikationsdesign die Grundlagen des Filmens. Warum müssen Designer filmen können?
Andreas Bechtold: Aus zwei Gründen. Erstens weitet sich das Berufsprofil, von Kommunikationsdesignern wird immer öfter erwartet, dass sie auch kleinere filmische Aufgabenstellungen übernehmen, etwa die Erstellung kürzerer Imagefilme, Webclips, Logo-Animationen, Making-ofs oder 30-Sekünder für Instagram und Facebook. Zweitens arbeiten nicht wenige Absolventen in größeren Agenturen, wie z. B. Ogilvy, wo sie mit großen Werbefilmproduktionen zu tun haben. Sie müssen also Storyboards lesen können und die Fachbegriffe kennen.
Die meisten werden zu Studienbeginn wohl schon eine Fotokamera in der Hand gehabt haben, die wenigsten eine Filmkamera. Wie steil ist die Lernkurve?
AB: Technisch gesehen, ist der Umstieg kein Problem – abgesehen davon, dass nicht wenige am Anfang die hohe Datenmenge unterschätzen. Die eigentlichen Herausforderungen liegen eher auf der gestalterisch-konzeptionellen Ebene. In der Fotografie geht es ja darum, die stärksten Augenblicke herauszudestillieren, im Film hingegen um ganze Szenen. Das ist schon deshalb schwieriger, weil das Motiv in Bewegung eingefangen wird und man nicht weiß, wann sozusagen die „Pointe“ der Szene erfolgt.
Die meisten unserer Leser setzen sich erst seit Kurzem mit dem Thema Bewegtbild auseinander. Wo liegen die Herausforderungen für Anwender, die vom Stillbild kommen?
AB: Was sich gelernte Designer, aber auch viele Fotografen oft erst aneignen müssen, ist das Rhythmusgefühl. Ein Film lebt von Szene- und Perspektiv-Wechseln und Geschwindigkeits-Alterationen, etwa durch eine bestimmte Abfolge von kurzen und langen Einstellungen oder den Einsatz von Zeitlupe oder Zeitraffer. Außerdem muss man beim Film noch genauer überlegen, ob die Voraussetzungen stimmen, etwa das Licht. Eine spätere Korrektur in der Postproduktion ist – anders als bei fotografischen Aufnahmen – meist impraktikabel, schon wegen der großen Datenmengen. Auch mit Blick auf die Dramaturgie ist ein durchdachtes Vorgehen unabdingbar.
Wo liegen hier die Herausforderungen?
AB: Grundsätzlich muss jede Einstellung eine Funktion übernehmen – ein reines Bildersammeln reicht also nicht. Vielmehr sollte man sich vorher genau überlegen, was man an Takes braucht, um eine schlüssige Geschichte zu erzählen – und das ist oft eine ganze Menge „Stoff“. Filmemacher sind also oft noch mehr in Bewegung als Fotografen.
Wieso so?
AB: Angenommen Sie drehen einen Hochzeitsfilm, dann brauchen Sie beispielsweise von der Ringübergabe nicht nur ein, zwei ikonische Bilder, sondern idealerweise eine Totale und auch ein Close-up, am besten noch aus der Perspektive des Bräutigams, der Braut, des Pfarrers und der Brauteltern. Da gilt es, schnell zu agieren, vorauszudenken und Optionen aufzumachen, sonst lässt sich das später nicht vernünftig schneiden. Ein Kollege hat mal gesagt: „Filmen ist wie Basketball spielen: Du dribbelst unten dem Korb und versuchst, einen Abschluss zu machen. Gleichzeitig musst du den Überblick behalten und das Geschehen aus der Vogelperspektive betrachten, damit du weißt, was als Nächstes passiert und was du möglicherweise noch einfangen musst.“
Gibt es Dinge, die man beim Filmen nicht erlernen kann?
AB: Lernen kann man eigentlich alles. Womit sich viele allerdings schwertun, ist das Storytelling. Um beim Beispiel Hochzeit zu bleiben: Neben den obligatorischen Momenten kann es beispielsweise interessant sein, zu erfahren, was in den Eltern vorgeht, wenn das einzige Kind heiratet. In solchen Situationen sollte man als Filmemacher geradezu journalistisch vorgehen und fragen: Wie geht es Ihnen, was empfinden Sie? Es ist der Versuch, zu erkunden, was hinter den Bildern steckt – und welche Bilder die ganze Geschichte erzählen.
Gilt das auch für Corporate-Filme?
AB: Sicher. Angenommen Sie produzieren einen Imagefilm für einen Automobilhersteller. Dann reicht es nicht aus, in Jäger-und-Sammler-Manier möglichst viele ansprechende Bilder einzufangen. Diese müssen vielmehr zum Selbstverständnis, zur Tradition des Unternehmens und seiner Corporate Identity passen. Gleichzeitig sollen vielleicht Innovationen oder Alleinstellungsmerkmale sichtbar werden. Man muss den Kunden also fragen: Ist das das Bild von euch, dass ihr aktuell transportieren möchtet? Als Filmemacher ist man immer zu einem gewissem Teil auch Unternehmensberater.
Die Budgets im Filmbereich befinden sich im Sinkflug, jedenfalls für kleinere Dienstleister. Wie realisiert man mit kleinem Budget einen schlagkräftigen Film?
AB: Kurz gesagt: Wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, ist die gute Idee das A und O.
Wie könnte das in der Praxis aussehen?
AB: Ein Beispiel: Ich habe meinen Studenten die Aufgabe gestellt, einen Werbeclip für ein fiktives Produkt namens „Sirchu“ (angelehnt an den englischen Begriff „Search you“, Anm. d. Red.) zu entwickeln, das das Auffinden verloren gegangener Objekte erleichtert. Eine Studentengruppe hat dies besonders originell umgesetzt. Die Studenten haben eine Art Kurzkrimi gedreht, in dem eine Einbrecherband ihre Autoschlüssel in der ausgeräumten Wohnung vergisst, dank „Sirchu“ schließlich wiederfindet, dabei aber von der Polizei hochgenommen wird, weil diese ebenfalls mit „Sirchu“ arbeitet. Das Ganze hatte viel Charme und dank Tatort-Ästhetik einen hohen Hinguck-Faktor, obwohl die finanziellen Mittel der Studenten überschaubar waren.
Apropos Ästhetik: Welche Trends beobachten Sie?
AB: Die Vorliebe für entsättigte, kontrastreiche Bilder mit starkem Gegenlicht, leichten Steadycam-Bewegungen, geringer bis sehr geringer Schärfentiefe und einer kontinuierlichen Schärfe-Verlagerung hält an. Manches davon wirkt etwas unmotiviert. Auch beim derzeit allgegenwärtigen Filmen mit Drohnen gibt es aus meiner Sicht Verbesserungspotenzial. Manchmal habe ich das Gefühl, das vor lauter Luftaufnahmen der Mensch etwas aus dem Fokus gerät. Zudem enden Drohnenfahrten selten glücklich. Um noch Mal das Beispiel Imagefilm für Autos aufzugreifen: Eine harmonische Drohnenfahrt könnte beispielsweise oberhalb des Fahrzeugs starten, und die Drohne könnte später neben dem Autofenster mitfliegen – so, wie man es früher mit dem Kamerakran gemacht hat.
Wo sehen Sie positive Entwicklungen?
AB: Als Bereicherung erlebe ich beispielsweise die inzwischen freiere Positionierung des Gegenübers in Interviewsituationen. Früher musste sich der Interviewpartner stets rechts und auf Augenhöhe befinden, jetzt darf er auch mal in die Bildmitte oder eine tiefere oder höhere Position einnehmen. Das empfinde ich als Gewinn, weil man so den inneren Zustand der Person sichtbar machen kann.
Hängen gestalterische Trends nicht immer auch mit der aktuellen Kameratechnik zusammen?
AB: Das ist so, ja. Technische Neuerungen haben in der Filmgeschichte immer auch ästhetische nach sich gezogen. In den 70er-
Jahren hat man beispielsweise das Zoom entdeckt – Filme wie Easy Rider oder Shaft sind voll davon. Später ist man dann wieder zu konventionelleren Einstellungen übergegangen.
Wie glauben Sie, wird die Technik die Art, zu filmen, in Zukunft beeinflussen?
AB: Sicherlich werden 4K-Smartphones auch im Profibereich eine gewisse Rolle spielen – Steven Soderbergh hat ja unlängst einen ganzen Film mit einem iPhone gedreht. Das wirkt auch auf den Stil zurück, denn Schärfeziehen ist ja aufgrund der Objektivtechnik nicht möglich – bislang jedenfalls. Auch VR-Anwendungen werden den Film beeinflussen. Wie, das lässt sich allerdings jetzt noch nicht wirklich vorhersagen.
Abschließend: Was sagen Sie Studenten, die gerne im Filmsegment Fuß fassen möchten?
AB: Ich rate ihnen, in Agenturen zu gehen, die sich auf das Thema Bewegtbild spezialisiert haben, etwa auf Web- oder Musikfilme. So lernt man den Markt kennen und wie man kalkuliert – Dinge, die wir im Studium nur zum Teil vermitteln können. Darüber hinaus entdeckt man so am besten, wo die eigenen Stärken liegen. Am Ende kann die Erkenntnis stehen, dass ich vielleicht vor allem ein guter Drehbuchautor, Cutter, Regisseur, Postproduktioner oder Tonmischer bin.
Lesen Sie weiter: